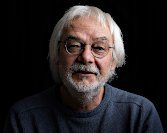Von Markus Dietze
„Die Polen hier in Polen hätten sich nicht einmischen sollen. Es ist richtig, unser König ist bei ihnen eingerückt mit Roß und Mann und Wagen, aber anstatt daß die Polen den Frieden aufrechterhalten haben, mussten sie sich einmischen in ihre eigenen Angelegenheiten und den König angreifen, wie er grad in aller Ruh bei ihnen einmarschiert ist. So haben sie sich eines Friedensbruchs schuldig gemacht, und alles Blut kommt auf ihr Haupt.“
Bertolt Brecht spielt in dieser Passage aus „Mutter Courage und ihre Kinder“ unverkennbar auf Hitlers Überfall auf Polen 1939 an – einen Angriffskrieg, in dem die Schuld in typischer Kriegslüge propagandistisch den Überfallenen zugeschoben wurde. Brechts satirische Überzeichnung macht die Absurdität dieser Täter-Opfer-Umkehr deutlich. Was als groteske Verzerrung oder rhetorische Volte erscheint, entpuppt sich als Teil einer Strategie, die Gewalt legitimiert, Verantwortung verschleiert und Widerstand delegitimiert.
Eigentlich ist es wünschenswert, schön und notwendig, dass Theater – selbst in der Interpretation historischer Stoffe – radikal gegenwärtig wird. Dass es Texte aus der Vergangenheit in Resonanz zur Gegenwart bringt und damit Zukunft verhandelbar macht. In dieser Fähigkeit zur Gleichzeitigkeit liegt seine gesellschaftliche Relevanz. Im Fall unserer Auseinandersetzung mit Brechts „Mutter Courage und ihre Kinder“ aber wird man auch uns Theaterkünstler:innen im Jahr 2025 gestatten müssen, einmal deutlich zu sagen: „Wir wünschten, es wäre nicht so.“ Wir wünschten, die Einsichten dieses Stücks müssten heute nicht wieder so schmerzlich erinnert und als Spiegel gegenwärtiger Zustände gelesen werden.
Dass das notwendig ist, bestürzt. Aber solange wir in der Lage sind, öffentlich zu streiten über Gerechtigkeit und Verantwortung, über Gewalt und Widerstand, solange wir sprechen können gegen Kriege, gegen die Logik eines entfesselten Neokapitalismus, der Kriege hervorbringt, gegen Nationalismus, Neofaschismus und despotische Regime – solange müssen wir es auch tun.
Als Russland im Jahr 2022 die Ukraine überfiel, erklärte die staatliche Propaganda Russland zum eigentlichen Opfer – ein Land, das sich, so Putin, gezwungen sah, auf eine Bedrohung zu reagieren, die es selbst definiert hatte. Der Westen: ein Aggressor. Die Ukraine: ein fremdgesteuertes Projekt. Die eigene Invasion: bedauerlich, aber notwendig. Diese Umkehrung der Wirklichkeit folgt exakt dem Muster, das Brecht in „Mutter Courage“ kenntlich macht.
Auch in den USA des Jahres 2025 lässt sich dieses Muster in den Diskursen der politischen Rechten beobachten: Unter Donald Trump erlebt die Täter-Opfer-Umkehr eine Renaissance in populistischer Verpackung. Trumps „America First“-Rhetorik kombiniert nationalistische Selbstüberhöhung mit der systematischen Verdrehung außenpolitischer Realitäten.
In solchen Denkmustern gilt Stärke als Recht, Widerstand als Provokation. Souveränität wird zur Option. Wer sich wehrt, trägt Schuld. Das ist keine rhetorische Polemik, sondern die innere Logik imperialistischer Ideologie, die eine Militarisierung der Politik, die Heroisierung von Gewalt und die Erzählung vom notwendigen Einsatz harter Mittel in einer angeblich gefährdeten Ordnung legitimieren soll.
Für eine wache Öffentlichkeit – und für das Theater – bedeutet das: Hinschauen. Nachfragen. Widersprechen. Die Verantwortung liegt bei denen, die angreifen – nicht bei denen, die sich wehren. Brechts Texte rufen uns gleichsam zu: Schaut hin. Zweifelt. Nehmt nichts als gegeben hin.
Die Logik autoritärer Regime zur Legitimierung von Gewalt stützt sich allerdings noch auf ein weiteres Prinzip: den kultivierten Entzug von Empathie. In den autokratisch-kapitalistischen Ordnungen unserer Gegenwart wird das Mitfühlen systematisch diskreditiert. Die Verrohung beginnt mit Sätzen wie: „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen“ oder: „Ich kann dieses Gejammer nicht mehr hören.“ Solche Sätze markieren nicht nur eine sprachliche Verhärtung, sondern verweisen auf eine politische Strategie: das Leiden anderer aus dem Blick zu nehmen, es zu delegitimieren oder zur selbstverschuldeten Randnotiz zu erklären.
Wo Empathie als Schwäche gilt, wird Elend zur Folge persönlicher Unzulänglichkeit. Der Hungernde hat nicht gearbeitet, der Geflüchtete zu spät reagiert, die Marginalisierten zu wenig getan, die Kriegsopfer hätten sich „nicht einmischen sollen“. Der Wert eines Menschen erwächst nicht mehr aus seiner Existenz als Mensch, sondern ist an Bedingungen geknüpft, die das diktatorische System ideologisch – und damit willkürlich – definiert.
Wo das Leiden anderer gleichgültig wird, lässt sich Gewalt als Ordnung, lässt sich ein Angriffskrieg als Notwendigkeit, lässt sich Unterdrückung als Reform verkaufen. Die gezielte Entemotionalisierung der Öffentlichkeit – sei es durch Zynismus, Spott oder strukturelles Wegsehen – ist kein Kollateralschaden der Autoritarismus, sondern eine der Voraussetzungen. Wir sehen keinen Nebenschauplatz dieser Ideologien – sondern eine Bedingung ihrer Funktionsfähigkeit.
Deshalb darf Theater, das sich mit solchen Verhältnissen auseinandersetzt, nicht nur analysieren, nicht nur zeigen, was ist. Es muss zusätzlich vor allem Räume schaffen, in denen das, was andernorts delegitimiert wird, wieder Geltung erhält: die Fähigkeit zur Empathie. Wer in der Lage ist, Schmerz nachzuvollziehen, kann ihn nicht mehr als systemischen Kollateralschaden verbuchen. Wer die Schicksale der Schwachen nicht nur erkennt, sondern berührbar bleibt, lässt sich nicht so leicht einreden, diese Schicksale seien irrelevant.
Gerade in einem Theater, das ideologiekritisch denkt und arbeitet, braucht es also beides: die klare Analyse und die entschiedene Geste gegen die Gleichgültigkeit. Eine kritische Praxis ohne Empathie bleibt abstrakt. Ein Theater ohne Empathie bleibt folgenlos.
+++
Weitere Infos zum Stück und den Koblenzer Aufführungen hier https://theater-koblenz.de/courage/